Moonraker
Space Karen, Libertäre und der rechte Rand der Zukunft
Ein durchgeknallter, superreicher Raketenbauer versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, um im Weltall eine Kolonie für Supermenschen zu schaffen, weil er ein verkappter Nazi ist … kommt dir das bekannt vor? Nein, ich spreche nicht von Elon Musk aka „Space Karen“, sondern von Hugo Drax, dem Bösewicht aus dem James-Bond-Film Moonraker aus dem Jahr 1979.
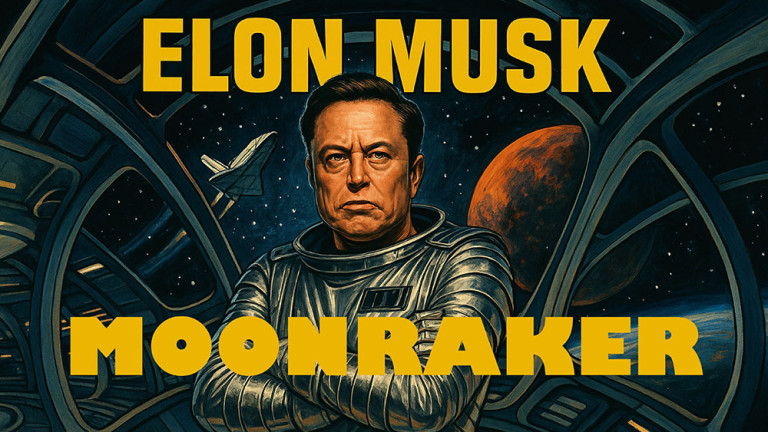
Einen Monat, bevor der Film in den englischen Kinos anläuft, bekommt das Land eine neue Premierministerin: Margaret Thatcher, die ein paar Jahre später in einem Interview mit dem Magazin Women’s Own den Satz sagen wird: „There is no such thing as society“. Doch was hat das beides miteinander zu tun?
Der Ursprung des libertären Autoritarismus
Margaret Thatcher gilt rückblickend als eine der ersten führenden Politikerinnen, die libertäre Ideen in reale Machtpolitik überführt haben. Sie bringt den ideologischen Kern dieses Denkens scharf auf den Punkt: Es gibt keine kollektive Verantwortung, kein übergeordnetes soziales Gefüge – nur Individuen und ihre Familien. Damit stellte sie nicht nur den Wohlfahrtsstaat infrage, sondern auch das grundlegende Prinzip gesellschaftlicher Solidarität. Diese Sichtweise ist typisch libertär: Der Einzelne ist allein verantwortlich für sein Schicksal, staatliche Umverteilung oder Fürsorge gelten als illegitime Eingriffe in die natürliche Ordnung von Markt und Leistung.
Thatcher verband diese radikale Marktgläubigkeit mit einer autoritären Politik der inneren Sicherheit, des staatlichen Durchgreifens und der Disziplinierung von Protest – etwa gegen Gewerkschaften. Genau in dieser Mischung aus wirtschaftlichem Ultraindividualismus und repressivem Machtanspruch zeigt sich der libertäre Autoritarismus in Reinform.
Während liberale Positionen staatliche Eingriffe zur Sicherung von Chancengleichheit oder sozialen Ausgleich akzeptieren, lehnt der Libertarismus solche Eingriffe ab. Er fordert einen Minimalstaat, der lediglich Eigentumsrechte schützt und individuelle Selbstbestimmung garantiert – jedoch ausschließlich nach seinen eigenen Maßstäben. Libertärer Autoritarismus entsteht dort, wo diese extrem freiheitsbetonte Ideologie mit der Bereitschaft einhergeht, autoritäre Maßnahmen einzusetzen, um die eigene Vorstellung von Ordnung, Eigentum und Freiheit gegen als bedrohlich empfundene Kräfte – wie etwa den Staat, Minderheiten oder politische Gegner – zu verteidigen. So paart sich radikaler Individualismus mit repressiven Tendenzen – Freiheit für die einen, Kontrolle für die anderen.

Die digitale Wiedergeburt des Anti-Sozialen
Als Margaret Thatcher verkündete, es gäbe „no such thing as society“, war das ein Frontalangriff auf die Idee kollektiver Verantwortung. Heute feiert dieses Denken ein digitales Comeback – mit Elon Musk als Gallionsfigur.
Was einst als technologische Avantgarde galt, wird zunehmend zur ideologischen Projektionsfläche für eine neue Form autoritärer Freiheit. In der Welt der Startups und Tech-Eliten dominiert ein Denken, das sich als rebellisch und unkonventionell inszeniert, dabei aber im Kern zutiefst systemkonform – oder gar systemzerstörerisch – ist. Der libertäre Autoritarismus findet hier seinen digitalen Ausdruck: Der Staat gilt als übergriffig, Steuern als Diebstahl, Regulierung als Feind des Fortschritts. Stattdessen soll der freie Markt, verkörpert durch ein paar selbsternannte Genies, die Zukunft gestalten – ungestört, ungewählt, unangreifbar.
Die Tech-Bros und ihr autoritärer Freiheitsbegriff
Die neuen Tech-Bros geben sich gern als unangepasste Freigeister, als digitale Cowboys, die mit Code die Welt retten. In Wahrheit aber stehen sie oft für eine politische Agenda, die Macht zentralisieren und Demokratie marginalisieren will. Peter Thiel, einer der einflussreichsten unter ihnen, hat nicht nur erklärt, dass Demokratie und Freiheit „nicht zwangsläufig miteinander vereinbar“ seien – er zitiert offen autoritäre Denker und finanziert politische Bewegungen, die demokratische Institutionen gezielt schwächen. Während er sich als Verfechter von Innovation inszeniert, investiert er zugleich in Überwachungsfirmen und profitiert von staatlicher Deregulierung, die seine Marktstellung absichert.
Gleichzeitig stilisieren sich Thiel, Musk & Co. als Symbolfiguren einer vermeintlich reinen Leistungsgesellschaft. Sie verweisen auf ihren „self-made“-Status, blenden dabei aber systematisch aus, dass ihr Aufstieg ohne öffentliche Infrastruktur, Forschung, Bildung und Subventionen kaum möglich gewesen wäre. Die gesellschaftliche Basis ihres Erfolgs wird unsichtbar gemacht – oder gleich ganz negiert. Gesellschaft? Gibt es nicht. Verantwortung? Privatsache. Das ist Thatcherismus auf Ketamin.
Feudalismus im Silicon-Valley-Gewand
Was als „Disruption“ gefeiert wird, ist oft schlicht Machtverschiebung – weg vom Gemeinwesen, hin zu einer kleinen, aggressiv auftretenden digitalen Aristokratie. Wenn Plattformen, Mobilität, KI und selbst militärische Infrastruktur zunehmend in privaten Händen liegen, dann entsteht nicht mehr Innovation, sondern eine neue Form von Feudalismus. Die Tech-Eliten regieren nicht im Namen des Fortschritts, sondern im Sinne ihrer Portfolios.
Besonders perfide ist die Doppelstrategie: Einerseits wird der Staat als überflüssig oder gar als Feind dargestellt, andererseits wird er strategisch genutzt – etwa über Subventionen, Gesetzeslücken oder politischen Einfluss. Diese Haltung ist nicht nur widersprüchlich, sondern zutiefst undemokratisch. Sie schafft Freiräume nicht für alle, sondern für wenige. Für jene, die sich bereits am oberen Ende der Machtleiter befinden – die neuen Könige des digitalen Zeitalters.
Gesellschaft ist kein Hindernis, sondern Voraussetzung
Es braucht eine klare Gegenbewegung: ein Verständnis von technologischem Fortschritt, das nicht von Oligarchen getragen wird, sondern von öffentlicher Verantwortung, demokratischer Kontrolle und kollektivem Wissen. Denn keine App, kein Startup, kein milliardenschweres Moonshot-Projekt entsteht im luftleeren Raum. Ohne NASA kein SpaceX, ohne öffentliche Bildung keine Entwicklerinnen, ohne staatliche Forschung kein Internet. Der libertäre Autoritarismus der Tech-Bros mag Freiheit versprechen – aber oft endet er in ihrer systematischen Demontage.

Was wir brauchen, ist kein neuer Glaube an den Unternehmer als Heilsbringer. Wir brauchen Institutionen, Regeln und Räume, in denen technologische Innovation dem Gemeinwohl dient – nicht seiner Demontage. Es reicht nicht, „Gesellschaft“ für tot zu erklären. Wir müssen sie verteidigen, gerade gegen jene, die sie nur noch als Hindernis für ihr persönliches Imperium sehen.
Die politische Leerstelle inmitten der Krise
Diese Ideologie des radikalisierten Individualismus mag sich auf Freiheit berufen, doch sie verkennt die Realität, in der sich individuelle Entscheidungen immer auch in einem sozialen und politischen Kontext entfalten. Der libertäre Reflex, jede Form kollektiven Handelns als Einschränkung zu sehen, scheitert regelmäßig an genau dem, was er ignorieren will: der Tatsache, dass Menschen in komplexen Beziehungen zueinander stehen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch.
Wenn jeder nur für sich selbst handelt, entstehen keine harmonischen Märkte, sondern systemische Krisen: ökologische Übernutzung, soziale Spaltung, digitale Monopole. Der libertäre Glaube, dass sich aus dem freien Spiel individueller Interessen automatisch das Gemeinwohl ergibt, blendet aus, dass kollektive Probleme kollektive Lösungen brauchen – und dass der Staat oft nicht das Problem, sondern das Gegenmittel ist.
Ohne verbindliche Regeln, demokratische Institutionen und geteilte Verantwortung kollabieren nicht nur soziale Sicherheiten, sondern auch die Grundlagen jener Freiheit, auf die sich die Tech-Eliten so gern berufen. Freiheit ohne Gesellschaft ist keine Freiheit – sie ist Rückzug, Zynismus oder schlicht das Recht des Stärkeren. Eine gerechte Zukunft beginnt nicht bei der Maximierung individueller Vorteile, sondern bei der Anerkennung unserer gegenseitigen Abhängigkeit. Wer wirklich an Fortschritt glaubt, muss zuerst an Gesellschaft glauben – und daran, dass sie gestaltbar ist.
Der Kapitalismus im Ausnahmezustand
Während die Tech-Bros vom Ende staatlicher Ordnung träumen und libertäre Vordenker die Gesellschaft zur Illusion erklären, zeigen die realen Entwicklungen längst, dass nicht zu viel Staat, sondern zu wenig Verteilung, Regulierung und Verantwortung unser größtes Problem ist. Die globale Vermögenskonzentration hat ein Ausmaß erreicht, das jede demokratische Legitimation untergräbt: Ein Bruchteil der Menschheit kontrolliert den Großteil des Reichtums – und damit die Ressourcen, die eigentlich Grundlage für gemeinsames Leben sein sollten.
Der Kapitalismus in seiner heutigen Form, lange gefeiert als Motor für Innovation, Mobilität und Wohlstand, wirkt zunehmend wie ein System am Limit. Die Jagd nach maximalem Profit führt nicht nur zur sozialen Erosion, sondern auch zur ökologischen Erschöpfung. Die Krisen unserer Zeit – von der Finanzkrise über die Klimakatastrophe bis hin zu globalen Lieferkettenbrüchen – sind keine Ausrutscher, sondern Symptome eines Wirtschaftssystems, das systematisch über seine planetaren und sozialen Grenzen hinausgeht.

Wir stehen an einem Punkt, an dem sich multiple Krisen überlagern: ökologische Kipppunkte, wirtschaftliche Instabilität, soziale Polarisierung, technologische Machtkonzentration. Diese „Polykrise“ – das gleichzeitige und sich gegenseitig verstärkende Auftreten verschiedener systemischer Spannungen – macht deutlich, dass es kein „Zurück zur Normalität“ geben kann. Denn diese Normalität war bereits das Problem.
Das Sein bestimmt das Bewusstsein
Aber um überhaupt über eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nachdenken zu können, braucht der Mensch eines: ökonomische Sicherheit. Oder, mit Marx gesprochen: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wer permanent mit der Sorge um die nächste Mietzahlung, die Stromrechnung oder das Essen am Monatsende beschäftigt ist, hat schlicht keine geistige Kapazität, um über Systemfragen zu reflektieren. In einem Zustand ständiger materieller Unsicherheit wird politische Vorstellungskraft zur Luxusware. Die radikalsten Ideen entstehen selten in leerem Kühlschrank. Wer wirklich Wandel will, muss erst die Bedingungen schaffen, unter denen Denken wieder möglich wird – jenseits von Existenzangst. Das ist die vordringlichste Aufgabe linker Politik jetzt, um dann möglichst schnell an das Grundproblem gehen zu können. Viel Zeit bleibt uns nämlich nicht mehr, denn es macht keinen Unterschied, ob man mit einem Verbrenner oder mit einem E-Auto bei 200 km/h auf eine Wand zurast.
Alle Blogs in der Übersicht...
Quellen:
Jaff, A. (2025, Februar 3). Musk als Vorbild: Rückt die Startup-Szene nach rechts?. Surplus Magazin.
Nayeri, F. (2023). Kapitalismus in der Krise. Roland Berger.
